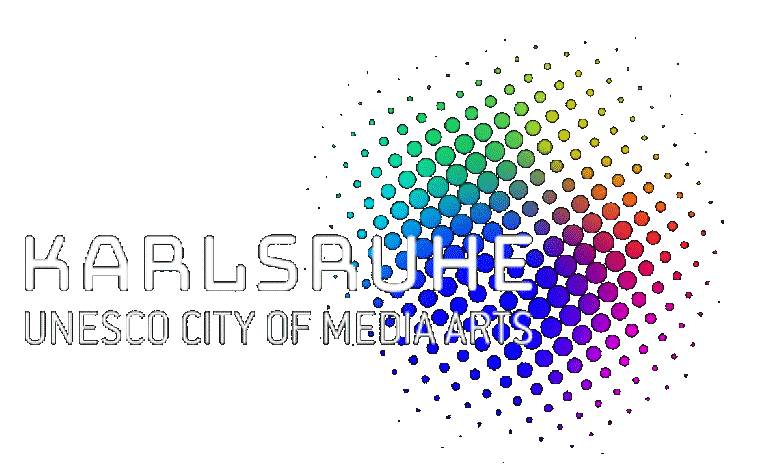Was ist Medienkunst für uns?

Medienkunst – eine Definition
Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts wurden die Medien in etablierte Formen wie Fotografie und Film und neue Medien wie Video und Computer unterteilt. Das vorherrschende Verständnis war dem Medienbegriff von Marshall McLuhan geschuldet, den er 1964 in seiner Publikation Understanding Media: The Extensions of Man vorstellte: Ein Medium ist „jegliche Erweiterung unserer selbst“. Diese Definition steht in einer langen Tradition, die man von Ernst Kapp (Die Organprojektion, 1877) bis hin zu Sigmund Freud (Das Unbehagen in der Kultur, 1930) verfolgen kann. So ist beispielsweise das Rad die Verlängerung des Beines, Mikroskope und Teleskope Erweiterungen des Auges, und der Computer, laut John von Neumanns The Computer and the Brain (1958), eine Erweiterung des Nervensystems.
Neue Disziplinen und Forschungsfelder, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden sind, wie die Automatenkunde, die Kybernetik, die Informations- und Kommunikationstechnologien und die künstliche Intelligenz erweiterten allmählich den Medienbegriff. Heute definiert sich Medienkunst als eine Kunstform, die eine von drei Bedingungen erfüllen muss: apparative Produktion, apparative Distribution und apparative Rezeption. Zeitungen und Fotos werden mit Druckmaschinen und Kameras produziert; ihre Inhalte sind jedoch mit bloßem Auge sichtbar. Manuskripte werden seit der Erfindung des Buchdrucks mithilfe von Apparaten wie der Schreibmaschine geschrieben. Und Musik wird seit den Erfindungen des Grammophons, des Tonbandgerätes und des Plattenspielers von einem Träger abgespielt. Auf diese Bedingungen verweist der Medientheoretiker Friedrich Kittler mit dem Titel seines Buches, Grammophon, Film, Schreibmaschine (1999, deutsche Version 1986). All diesen Fällen gemein ist die Herstellung, Aufzeichnung und anschließende Wiedergabe von Werkinhalten durch Maschinen, Instrumente und Apparate, womit wir beim Themenkomplex der Distribution und Speicherung angekommen sind. Radio und Fernsehen sind klare Beispiele für apparative Produktion, Sendung und Empfang. Die Aufzeichnung, Vermittlung und Wahrnehmung von Informationen in Video und Film basieren ebenfalls auf Geräten (dem Monitor und dem Filmprojektor), wobei sie im Gegensatz zu Radio und Fernsehen in ihrer Rezeption lokal gebunden sind. Im Zeitalter des Internets haben wir Computer für die Produktion von Informationen, das Internet für ihre Verbreitung und wiederum Computer, Mobiltelefone und andere Geräte für den Empfang von Informationen. Wir leben heute in einem geschlossenen Kreislauf aus apparativ gestützter und aufrechterhaltener Produktion, Verbreitung und Rezeption von Information. Die Medien sind zu einem allgemeinen Informationsumfeld geworden.
Speicher- und Aufzeichnungstechnologien spielen eine wichtige Rolle bei der Charakterisierung der drei genannten Bedingungen. Sie stellen eine vierte Bedingung dar, weil die technologischen Eigenschaften der Speicherung die Konfiguration der Medien und damit ihre Potenziale bestimmen. Fotografie und Analogfilm verfahren über chemische Speicherung, wodurch die von ihnen aufgezeichneten Information nicht im Nachhinein verändert, sondern lediglich gelöscht werden kann. Die magnetische Speicherung in Tonband und Videoband ist hingegen manipulierbar. Auf diesem Weg haben elektrische Schaltkreise und elektromagnetische Speicherung weitere Freiheitsgrade eröffnet. Die Veränderbarkeit elektronisch gespeicherter Information macht aus dem Bildfeld eine Matrize aus Variablen, deren Wert vom Programmierer definiert werden kann. Dahingehend lässt sich feststellen, dass die Digitalität von Computerbildern und -grafiken eine neue Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine eingeführt hat: ein neues Modell der Kommunikation zwischen Mensch und Maschine, vermittelt durch die grafische Benutzeroberfläche. Das Feld der Schnittstellen wurde erweitert, mitunter durch Sensoren, die Informationen aus der Umwelt sammeln und an andere Einheiten weitergeben.
Der Bruch mit den traditionellen Trägermedien erfolgte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit der Einführung magnetischer und elektronischer Aufzeichnungs- und Projektionsmedien. Der Computer vereint Rechner, Schreibmaschine, Zeitmaschine, Bildmaschine und Tonmaschine. Die apparativen Künste verschmolzen zu einer universellen Maschine.
Mit dem Computer wurde der Inhalt bisheriger Medien wie Schrift, Bilder, Töne in Daten umgewandelt. Medien stellen heute somit eine Art universelle Sprache dar, ein universelles System das Daten produziert, speichert, sendet, austauscht und empfängt. Im Zusammenschluss mit Sensoren und Schnittstellen als Rezeptoren und Effektoren sowie mit Algorithmen und künstlicher Intelligenz, die Steuerungsprinzipien konfigurieren und ermöglichen, sind Medien zu einem Expertensystem geworden, das auf elektronischen Geräten und der Verwaltung von Daten basiert.
Technologie ist dahingehend nicht nur ein Mittler, sondern ein Phänomen von großem Transformationsvermögen, das paradigmatische Veränderungen in Feldern wie der Wissenschaft, Regierungs- und Gesundheitswesen, Finanzsystemen, Infrastruktur, Landwirtschaft, Genetik, Telekommunikation bewirkt. Folglich bestimmt dieses Transformationspotenzial, bezogen auf jedwede relevante soziale, wissenschaftliche oder rein künstlerische Fragestellung, das Wesen der Medienkunst und unterscheidet sie von anderen Kunstformen.
Medienkunst bringt nicht notwendigerweise Objekte, Installationen oder Artefakte hervor. Ihr schwer fassbarer Charakter leitet sich aus den oft ephemeren, wenn nicht vollständig als immateriell wahrgenommenen Phänomenen her, die sie sich zu eigen macht. Medienkunst kann zum Beispiel softwarebasiert sein, wodurch sie nur auf Computerbildschirmen wahrzunehmen ist; materielle Präsenz definiert also nicht den ontologischen Status eines Medienkunstwerks. Daher lässt sich über die Kunst des Programmierens, über die algorithmischen Künste, und weiteres derart sprechen.
Medienkunst ist Aktivismus, wenn sie Missstände, zum Beispiel die mangelnde Transparenz in der Gestaltung von Politik oder die Diskriminierung von Minderheiten in Bezug auf und mittels Technologie selbst kritisiert, mit dem Ziel, die öffentliche Meinung und mögliche Gesetzgebung zu beeinflussen.
Medienkunst ist performativ. Sie ist partizipativ und interaktiv. Ohne die Betrachter, die das Kunstwerk in Bewegung setzen, würde es das Kunstwerk nicht geben. Medienkunst bedarf somit der Aktivierung; weshalb wir bei dieser Kunstform nicht mehr über die Betrachtenden, Zuschauenden oder Beobachtenden sprechen, sondern über die Benutzer*innen. Medienkunst ist Benutzerkunst. Die Nutzer*innen, vormals die Zuschauer*innen, sind die Daseinsberechtigung der Medienarbeit; sie sind für ihre spezifische Seinsform die Voraussetzung. Die Arbeit entsteht erst durch die Beteiligung der Nutzer*innen und existiert somit im Interaktionsbereich zwischen Nutzenden und Kunstwerk, was den ontologischen Status des Kunstwerks radikal verändert. Wie oben erwähnt speichern elektronische Medien Informationen virtuell, wodurch das Bild die Struktur eines durch Variablen geordneten Feldes annimmt. Infolge dieser Tendenzen hin zur virtuellen Speicherung und der dadurch bedingten Variabilität der Inhalte geben sich nun weitere Verhaltensmuster zu erkennen, die den Eigenschaften des digitalen Kunstwerks entspringen: Es verhält sich wie ein lebender Organismus. Daher können wir über eine lebensähnliche Vitalität des Medienkunstwerks sprechen. Mit dieser neuen, zusätzlichen Abgrenzung der Medienkunst vom herkömmlichen Werkbegriff treten wir in die Phase der digitalen Kunst, der Augmented, Virtual oder Mixed Reality und in den Bereich der BioArt ein.
Die Medienkunst ist somit sozial engagiert – sie vollzieht eine kontinuierliche Kartierung der Auswirkungen von Technologien auf die Gesellschaft, weist auf bestehende technosoziale Konfigurationen hin oder schlägt fiktive Szenarien vor, die im sozialen Wandel bereits von Bedeutung sind, oder es in Zukunft sein könnten.
Die Medienkunst ist in der Ära der post-media condition (Weibel, 2006), in der „kein einziges Medium mehr vorherrscht, sondern alle verschiedenen Medien sich wechselseitig bestimmen und beeinflussen“, nicht mehr an ein bestimmtes Medium gebunden. Medienkunst ist heute universal.